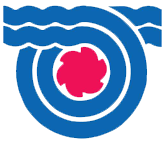FLOW-Projekt
Seit fünf Jahren gibt es das FLOW-Projekt – ein Citizen-Science-Projekt, das kleinen Flüssen und Bächen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ziel ist es, das Makrozoobenthos kleiner Flüsse zu erforschen. Als Makrozoobenthos bezeichnet man die wirbellosen Kleintiere, die als wichtige Bioindikatoren den Zustand unserer Gewässer widerspiegeln. Dazu haben wir ein kurzes Interview mit ihm geführt:
Was hat Sie an diesem Projekt gereizt?
Mich hat besonders der Charakter als Science-Social-Projekt begeistert: Bürgerliches Engagement wird hier aktiv eingebunden und wissenschaftlich begleitet. Die Resonanz war überwältigend – immer mehr Gruppen kamen hinzu. Erfreulicherweise arbeiteten die meisten sehr engagiert und präzise, wie unabhängige Überprüfungen zeigten.
Wie läuft die Untersuchung vor Ort ab?
Wir untersuchen ca. 100 Meter lange Gewässerabschnitte, indem wir den Boden aufwirbeln, Steine abstreifen und die kleinen Tierchen in Netzen fangen. Dann werden sie unter dem Mikroskop untersucht und wieder in Freiheit gelassen. Außerdem wird das Gewässer auf eine Reihe von Chemikalien untersucht.
Ein solches Monitoring ist, wenn man es ernst nimmt, durchaus aufwändig: In der Regel arbeiten wir zu sechst einen vollen 10-Stunden-Tag intensiv zusammen. Dabei werden Arten bestimmt und gezählt. Unsere Gruppe ging hier noch einen Schritt weiter: Wir gehörten zu den ersten, die Kinder schon mit 10 Jahren aktiv eingebunden haben. Inzwischen sind die 13-14 Jahre und schon richtige Experten. Außerdem untersuchen wir speziell Abschnitte ober- und unterhalb natürlicher oder künstlicher Barrieren – vor allem an Wasserkraftstandorten.
Für mich als Gruppenleiter bedeutet so ein Arbeitstag noch zusätzlich 2–3 Stunden Vorbereitung und 7–18 Stunden Nachbereitung pro Untersuchung. Hinzu kommen ein jährlicher Weiterbildungstag in Erfurt sowie eine eintägige Projektkonferenz.
Ihre wesentlichsten Erkenntnisse aus mehreren Jahren Forschungsbegleitung? Was hat Sie überrascht?
Ich beginne mit der letzten Frage: Überrascht hat mich die Vielfalt des Lebens in dieser so kleinen Welt. Und mit welcher Vehemenz diese Tierchen übereinander herfallen, wenn man sie nicht rechtzeitig auseinanderhält. Das ist dann ein einziges Fressen und Gefressen-werden.
Ausgangspunkt des FLOW-Projektes ist das Wissen, dass gewisse Arten nur bei bestimmten Gewässerqualitäten auftreten. Bereits das Einbringen von Steinen aus anderen Gebieten kann für einige Arten das Todesurteil sein. Das sollten auch Wasserbauingenieure bedenken, wenn sie beispielsweise Kalksteine in saure Gewässer verkippen, um Flüsse zu "renaturieren".
Unsere spezielle Herangehensweise, die über das FLOW-Projekt hinausgeht, ist von der These ausgegangen, dass es oberhalb und unterhalb natürlicher und künstlicher Barrieren unterschiedliche Artenzusammensetzungen gibt, weil Fragmentierung eben der Artenvielfalt dient. Das wurde durch unsere Untersuchungen bestätigt. Und diesen Artengemeinschaften ist es egal, ob die Barriere dazwischen ein natürlicher Wasserfall, ein Biberdamm oder ein Wehr ist. Inzwischen gibt es auch groß angelegte Untersuchungen von Universitäten zu dem Thema, die zu dem gleichen Schluss kommen. Interessant sind die verschiedenen Bewertungen. Eigentlich sollte ja jeder Biologe wissen, dass eine Vielfalt der Habitate gut für die Artenvielfalt ist. Wenn ich statt dessen "Durchgängigkeit" für alle und alles plakatiere, wird es bald nur noch ein paar realsozialistische Einheitsarten geben.
Mir ist auch noch viel klarer geworden, dass ja viele unserer Insekten den Großteil ihres Lebens als Larven in den Gewässern verbringen. Für uns ist irgendwie nur das Erwachsenenstadium wichtig, weil wir die Tierchen dann vor Augen haben. Und vielleicht auch, weil bei uns Menschen das Erwachsenenstadium in der Regel die längste Zeit des Lebens ausmacht. Für viele Insekten ist das anders: Da ist Leben = Larve, und Erwachsenenstadium ein kleines Zeitfenster Richtung Tod. Wenn man sich das vor Augen hält, fragt man sich schon auch, ob es Sinn macht, einerseits Blühwiesen anzulegen und andererseits die Flüsse chemisch zu belasten und dazu massiv mit Fischen aus Fischzuchtanstalten zu besetzen, die die Gewässer dann leer fressen, bevor sie wieder herausgeangelt werden.
Erst vorletzte Woche waren wir an der Warmen Steinach im Einsatz. Wir bleiben weiter engagiert für unabhängige Forschung.
Durch Aktionen wie die ARD-Kampagne #unserefluesse wuchs die Bekanntheit des Projekts stetig.
Weitere Informationen zum Citizen-Science-Projekt unter: www.flow-projekt.de
04.07.2025